Ein
weisser Strich an der Berliner Mauer
Entstehung des Vorhabens
Im Spätsommer
1986 hatte der seit Anfang 1985 in Westberlin lebende, aus
Weimar stammende Jürgen Onißeit
die Idee, die Westseite der Berliner Mauer rundherum mit einem weißen
Strich zu versehen. Als bildender Künstler hatte Onißeit im
Kreuzberger "Künstlerhaus Bethanien" Zugang zu Arbeitsräumen
mit verschiedenen Druckmöglichkeiten und lernte dort andere Westberliner
Künst-
ler kennen. In den mittleren 80er
Jahren war die Berliner Mauer besonders in dem von mit Sprüchen Symbolen
und Bildern reichhaltig besprühten Hausfas-
saden Kreuzbergs zu einer Freifläche
künstlerischen, politischen, im Grunde jeweden Ausdrucks geworden.
So schreibt der Musiker Alexander Hacke: „Vom Fenster seines Zimmers im
Rauch-Haus schaute er (der Streetart-Künstler Thierry Noir... d.Verf.)
direkt auf die Mauer, die zu diesem Zeitpunkt (1982/83...d.Verf.) ausschließlich
mit politischen Parolen beschriftet war. Eines Nachts, im April 1984, hatte
er die im Nachhinein historische Eingebung, die deprimierende Zonengrenze
mit bunten großflächigen Malereien zu dekorieren und er machte
sich augenblicklich mit Pinsel, Farbeimer und einer Baulampe bewaffnet
ans Werk. Ein weiterer französischer Künstler, Christophe Bouchet,
der ebenfalls im Rauch-Haus wohnte, beteiligte sich gleich am nächsten
Tag an Thierrys Arbeit und in kürzester Zeit hatten die beiden mehr
als einen Kilometer der Kreuzberger Mauer am Bethanien grundiert und zu
bemalen begonnen. Natürlich dauerte es nicht lange, bis auch Kiddy
und ich bei dem Spaß mitmachten.“ (Alexander Hacke, „Krach“ S.82)
Jürgen Onißeit hatte Monate
vor seiner Idee zur Strich-Aktion zusammen mit seinem Bruder selbst die
Mauer mit einem Bild versehen, doch inzwischen stör-
te er sich an den Mauermalereien.
Seine Absicht war es, den Konsens, der bei den Künstlern in seinem
Umfeld über die kreative Nutzung der Berliner Mauer bestand, infrage
zu stellen und letztlich zu negieren. Das künstlerexzentrisch motivierte
Provozieren seiner Kollegen aus dem "Bethanien" dürfte dabei einer
seiner primären Beweggründe für sein Vorhaben gewesen sein.
Das "Künstlerhaus Bethanien"
befand sich in Kreuzberg direkt an der Berliner Mauer und war nur durch
einen kleinen Weg von dieser getrennt. Für die
Zerstörung der Mauerkunst seiner
Kollegen schien daher der ideale Startpunkt der Aktion des weissen Strichs
der Mauerbereich vor dem "Bethanien" zu sein, weil sich dort auch zahlreiche
der Malereien der Bethanienkünstler befanden und sich von dort aus
nach beiden Richtungen der Mauer ausdehnten. Ein zweiter Beweggrund für
den weißen Strich bestand darin, die städtischen Lebensraum-Grenzen
Westberlins durch einen beabsichtigten weissen Grenz-
Strich zu verdeutlichen. Grenz-Strich
sollte er nicht im Sinne der exakten, von den vier Siegermächten des
2.Weltkrieges festgelegten Berliner Sektoren- und später Teilungs-Grenze
sein, welche sich fünf Meter vor der Westseite der Mauer befand.
Vielmehr sollte er jene dem Westberliner Einwohner durch den Berliner Mauerbau
aufgezwungene reale physische Grenze deutlich markieren, weil nach J.Onißeits
Auffassung diese Grenze aufgrund der Virtualisierung der Mauer durch
Bild- und andere Botschaften nicht mehr richtig bewußt gewesen ist.
Die Markierung der Grenze würde
deshalb mit einem demonstrativen Durch-
streichen der Mauermalereien
einhergehen und im Bewußtsein des Betrachters eine Art Re-Realiserung
der Wirkung der Mauer hervorrufen, die durch die
zahlreichen Bebilderungen gewissermaßen
de-realsiert worden war.
Wie dezidiert die Motivlage bei den
anderen Beteiligten war spielt letztlich gar keine Rolle. Es reichte, die
Idee mindestens akzeptabel zu finden und Lust auf solch eine Aktion zu
haben. Alles, was heute an ernsthaften Beweggründen der einzelnen
Teilnehmer und der Gruppe genannt wird ist teilweise vor allem in seinem
Notwendigkeitsgestus völlig übertrieben, teilweise als damalige
Motiv-
lage wahr, mitunter aber auch einfach
hinzugefügt.
Die ursprüngliche Provokations-
und Aktions-Lust als Hauptmotiv geht dabei völlig unter und taucht
dann allenfalls noch als Affekt-Stereotyp medial gene-
rierter Emotionaliserungsmuster
wieder auf.

Künstlerhaus Bethanien. 1973
vom Krankenhaus zum Künstlerhaus umgestaltet.
(Foto W.Hasch)
Ghettowall um Berlin
"Berlin" bezeichnete für Westberliner
damals Westberlin, wohingegen der Ostteil Berlins für Westberliner
Ostberlin hieß. Wenn Jürgen Onißeit später in seiner
an die Berliner Mauer geschriebene Aktionserklärung von Berlin spricht,
das von der Mauer als eine Art "Ghettowall" umgeben ist, so verstand er
die Bedeutung des Begriffs "Ghettowall" hier kaum in einer politischen
Ghettoi-
sierung, wie sie zum Beispiel im
Begriff des Warschauer Ghettos signifikant ist. Jürgen Onißeit
hatte als Punk mit dieser Ghettometapher eher die mit Graffitis und Sprüchen
besprühten Wohnghettos der Trabantenstädte im Fokus als eine
traditionell politische Metapher. Berlin war für ihn ein ummauertes
riesiges Wohnstadtghetto, dessen reale Situation der Eingrenzung durch
die Bebilderung seiner Stadtmauern verharmlost, harmonisiert und illusioniert
wurde. Die Realität der Begrenzung wurde de-realisiert, indem sie
sur-realsiert wurde und der künstlerische Exotismus der Mauermalereien
täuschte über das ganz und gar Unexotische der tatsächlichen
Situation hinweg. Dieser Sach-
verhalt sollte durch den gezogenen
Strich in das Bewußtsein der (West-)
Berliner Bewohner gelangen und das
nicht über die Medien, sondern direkt am Stein des Anstoßes:
der Berliner Mauer.
Nachdem die Idee zu dieser Strich-Aktion
geboren war unterbreitete Jürgen Onißeit sie in der unmittelbaren
Folgezeit seinen Freunden und Bekannten, um Teilnehmer dafür zu gewinnen.
Ein kleiner Teil der Eingeweihten verbreitete die Idee weiter, um ebenfalls
Teilnehmer dafür zu gewinnen. Mitmachen konnte jeder, egal welcher
Herkunft, denn es ging bei diesem zeit- und materialinten-
siven Vorhaben darum, daß
möglichst viele Personen sich an der Aktion beteiligten. Ob
er sich als Künstler verstand oder nicht, in West- oder Ost-
deutschland aufgewachsen oder ob
er überhaupt Deutscher war hatte bei der Erwägung über potentielle
Mitmacher keine Bedeutung.
Am Ende fanden sich neben Initiator
Jürgen Onißeit vier weitere Teilnehmer.
Allesamt Personen aus Onißeits
unmittelbarem Umfeld, zu dem insgesamt etwa 15 Personen gehörten.
Lutz Heyler (Ex-Ostberlin), Knut Angermann (Ex-
Kassel), Wolfgang Dietrich (Ex-Bayern),
Volker Otto (Ex-Weimar), Grit Ferber (Ex-Weimar), Alwin Derfuß (Ex-Nürnberg),
Pia Lazarewski (Ex-Kassel), Jan-
Georg Fischer (Ex-Weimar)
waren neben den späteren Mauerstrich-Malern
einige der Freunde Onißeits
aus dieser Zeit, von denen einige wiederum selbst miteinander befreundet
waren oder sich kannten. Daß sich am Ende dann mit Onißeits
Bruder Thomas sowie seinen Freunden Frank Schuster, Wolfram Hasch und Frank
Willmann vier ehemalige Weimarer zur Teilnahme an der Aktion fanden lag
weder daran, daß sie alle aus der DDR und zudem aus der gleichen
Stadt (Weimar) kamen noch daß sie angeblich eine Künstlergruppe
bildeten, wie Frank Willmann später öffentlich erklärte,
sondern vielmehr daran, daß alle als Schüler der "Schule
für Erwachsenenbildung" in dem anvisierten Aktions-
zeitraum Herbst-Ferien
und
zudem durch die Bafög-Zuschüsse für ehemalige DDR-Bürger
auch noch die nötigen Geldmittel zum Kauf der reichlich benötigten
weißen Farbe besaßen. Die anderen der angesprochenen Teilnehmer
hatten entweder das Geld nichtmal für einen kleinen Zuschuss
zu den Farbe-Kosten oder die Zeit nicht oder aber waren von der Idee zu
wenig angetan, daß der erforderliche hohe persönliche Einsatz
damit nicht ausreichend zu motivieren war. Hinzu kam auch ein gewisses
Risiko bezüglich möglicher Zwischenfälle mit den Grenzposten
der DDR, welche anders als bei aus der optischen Mauerdek-
kung operierenden und nur eine vergleichsweise
kleine Mauerfläche bemalen-
den Malern und Aktionskünstlern
zu erwarten waren. Die Strich-Aktion würde mindestens zwei Wochen
dauern, mußte, da die gesamte Mauer bemalt werden sollte auch MauerStrecken
passieren, die den Grenzposten von ihren Wach
türmen nach Westberlin einsehbar
waren und bot diesen zudem Zugriffsmög-
lichkeiten an potentiell jedem Punkt
der Westseite der Berliner Mauer, da die Malaktion an der gesamten Länge
der Mauer-Westseite auf dem noch zur
DDR gehörenden 5-Meterstreifen
stattfinden würde.
Am Ende hatten sich inklusive des
Initiators fünf Teilnehmer gefunden, deren Herkunft und Jugend-Biographien
teilweise eine Ähnlichkeit aufwiesen, die von den Medien 1986 und
vor allem 2010 dann ideal für eine Mythenbildung ver-
arbeitet werden konnte. Alle fünf
kamen aus Weimar und hatten dort Anfang der 80er Jahre zu einer kleinen
Subkultur aus anarchoid motivierten Normver-
weigerern gehört, durch
die sie sich seitdem kannten. Drei von ihnen (die Brüder Onißeits
und ich) waren in der DDR aus jeweils unterschiedlichen Gründen politisch
inhaftiert worden. In Westberlin hatten sie innerhalb des weiter oben erwähnten
grösseren Personenkreises Kontakt, davon einige miteinander sogar
intensiven. Eine Künstlergruppe bildeten sie jedoch nicht.
Die Teilnehmer:
Jürgen
Onißeit, geboren 1962, mußte eine Lehre als Elektroniker wegen
Prob-
lemen mit
den Ausbildern abbrechen und arbeitete später im Archiv einer Weimarer
Bibliothek. Seit ca 1981 Mitglied einer Punkband, vorher Hardrock-
Musiker. 1982
wegen Wehrdienstverweigerung zu 20 Monaten verurteilt wurde er nach
7 Monaten auf Bewährung entlassen. Als bildender Künstler malte
er und fertigte zahlreiche Holzschnitte. Nebenher wurde er als sogenannter
Vorlauf-IM
im Testmodus als MfS-Informant abgeschöpft. Im Februar 1985 wurde
J.Onißeit aufgrund seines Anfang 1984 gestellten Ausreiseantrages
nach Westberlin entlassen. Dort begann er 1986 an der "Schule für
Erwachsenenbildung" im Herbst 1986 das Abitur, was er später abbrach.
Thomas Onißeit,
geboren 1964. Verpflichtete sich zu einer Laufbahn als Berufsoffizier,
um einen Abiturplatz zu bekommen. Als er das Abitur trotzdem nicht absolvieren
durfte, verabschiedete er sich von seinen einstmaligen
realsozialistischen
Karriereplänen und wurde zunehmend "negativ-dekadent (Stasi-jargon).
Wegen einer nächtlichen Sprühaktion, bei der er zusammen mit
einigen anderen Weimarer Jugendlichen staats-,kriegs- und sinn-negierende
Parolen an die Fassaden Weimarer Gebäude sprayte wurde er wegen Rowdytum
im Frühjahr 1984 zu mehreren Monaten Haft verurteilt, die er
in der Untersuchungshaft absaß. Nach Verbüßung seiner
Haftstrafe arbeitete er als Fließbandarbeiter im Uhrenwerk, da ihm
Qualifikationsmöglichkeiten durch das Stigma der Haft verwehrt blieben.
Während dieser Zeit Mitte 1984 bis Mitte 1985 beteiligte er sich an
diversen künstlerischen Aktivitäten wie Performances und Super8-Filmen.
Im Herbst 1985 siedelte er im Zuge eines Monate zuvor gestellten Ausreiseantrages
nach Westberlin über. Dort begann er 1986 an der "Schule für
Erwachsenenbildung" im Herbst 1986 das Abitur, was er später abbrach.
Frank Willmann,
geboren 1963. Ausbildung als Maschinenschlosser, 1981/82 nach Ausstieg
aus aeinen bisherigen Lebensvorstellungen tätig als Altenhilfspfleger
und in der Weimarer anarchoiden Subkultur. Anfang 1984 Übersiedlung
nach Westberlin. Dort begann er 1986 an der Westberliner Schule für
Erwachsenenbildung das Abitur, was er später abbrach.
Wolfram Hasch,
geboren 1963. 1981 Lehr-Abbruch als Kaufmann. Anschließend
tätig
als Altenhilfspfleger. In dieser Zeit begann auch die Kamera-Überwa-
chung seines
Zimmers durch das Ministerium für Staatssicherheit. Im Januar 1984
wegen Flugblättern mit Aufruf zum Wahlboykott zusammen mit 3 Freunden
verhaftet. Im Juli 1984 wegen den Flugblättern sowie eines in der
Westberliner "tageszeitung" veröffentlichten Textes zu 30 Monaten
Haft verurteilt wurde er im Januar 1985 in die BRD entlassen, von wo aus
er nach Westberlin zog. Dort begann er 1986 an der "Schule für
Erwachsenenbildung" das Abitur, was er durch seine Haft abbrechen mußte
und nach Haftentlas-
sung
nicht mehr fortsetzte.
Frank Schuster.
Geboren 1964. Handwerkliche Berufsausbildung. Unterwegs in Weimars anarchoider
Subkultur. Anfang 1985 nach Westberlin ausgereist, wo er später an
der "Schule für Erwachsenenbildung" das Abitur begann, was er später
abbrach.
Bedauerlich ist im nachhinein, daß
bei der Gewinnung möglicher Teilnehmer
keine öffentlichen Aufrufe
an diversen Orten ausgehängt wurden. Durch solche zur Teilnahme einladenden
Bekanntmachungen hätte sich die Teilnehmerzahl erhöhen
können, wodurch das anvisierte Ziel hätte schneller erreicht
werden als auch die spätere Mythenbildung von der Ex-Weimarer Künstlergruppe
hätte vermieden werden können. Angesichts des inzwischen
bekannten Ausmaßes der Staatssicherheits-Infiltration des Westberliner
öffentlichen Lebens war es im nachhinein betrachtet dann doch besser,
daß diese Möglichkeit damals nicht wahrgenommen wurde.
Vorbereitungen
Die Vorbereitungen zur Aktion waren
geprägt durch zwei Aspekte. Zum einen war sie zwar als im weitesten
Sinne Kunst-Aktion gedacht, insofern der Strich als symbolisch-abstraktes
Zeichen auftreten würde und sich die Protagonisten als freie künstlerisch
tätige Personen verstanden, aber aufgrund der sponta-
neistischen Einstellung der Teilnehmer
war man von künstlerische Konzept-
Aktionen kennzeichnender Logistik
weit entfernt. Weder wurden Besonder-
heiten einiger Mauerbereiche ( in
Kreuzberg war es das an die Mauer gren-
zende Betriebsgelände des Springer-Verlages,
welches den Zugang zur Mauer verwehrte) noch die Realität der kleinen,
den Ostberliner Soldaten Zugang zur Westseite der Mauer verschaffenden
Türchen oder andere Grenzposten-Zu-
griffsmöglichkeiten erörtert.
Auch der Umgang mit eventuell auftretenden Me-
dien wurde nicht thematsiert. Ebensowenig
wie derjenige mit möglichen hefti-
gen Provokationen von Passanten
oder wütendem Widerstand von Malern, deren Bilder durchgestrichen
werden würden. Auch mögliche Ermittlungs-
strategien des MfS wurden nicht
in Betracht gezogen. Als später bei der Aktion eine Fotografin hinzustieß,
konnte sie auch Fotos in Situationen machen, in denen die Gesichtsmaskierung
abgelegt wurde, weil eine optische Anonymisierung an manchen Orten
nicht nötig war. Niemand der Maler dachte damals daran, daß
diese Fotografin durchaus vom Ministerium für Staats-
sicherheit geschickt worden sein
könnte.
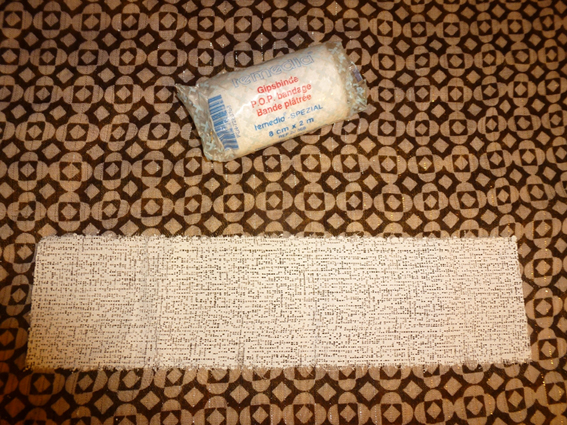
Gipsbinde aus einer Apotheke. Die
Binde wurde in 20 bis 25cm lange Teile zerschnitten, von denen dann mehrere
in Wasser getaucht und feucht über das Gesicht gelegt wurden, bis
es
ganz bedeckt war. Nach einigen Minuten
war die Maske trocken und konnte abgenommen
werden.
(Foto W.Hasch)
Neben der für ernsthafte Kunstaktionen
untypischen Mangel-Logistik kam noch hinzu, daß eine zeitlang unklar
blieb, wieviele Personen tatsächlich daran teil-
nehmen würden, sodaß
bestimmte Entscheidungen zunächst offen bleiben mußten, etwa
diejenige darüber, ob man die Berliner Mauer vielleicht sogar ganz
weiß anmalt, um sie als Grenze Westberlins noch deutlicher zu machen.
Als sich aber die Teilnehmerzahl dann als höchstwahrscheinlich im
einstelligen Bereich bleibende heraustellte ließ man von dieser Idee
ab. Farbmaterial und zeitlicher Malaufwand beim Weißen der gesamten
Berliner Mauer waren von fünf Personen mit der freien Zeit und den
finanziellen Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen, eindeutig nicht
zu bewältigen.

Gesichtsmaske aus Gipsbinden-Stücken.
Nach dem fertigen Gesichtsabdruck wurde die
Maske noch mit Gips stellenweise
verformt und anschließend bemalt. (Foto: W.Hasch)
Sich "die Mauer" einverleiben
Man kann bei der Strich-Aktion von
einer doppelten Grenzerfahrung sprechen:
die Erfahrung der territorialen
Grenze und die des eigenen Körpererlebens. Denn eine weitere Absicht
während der Malaktion war es, sich am Ende eines Maltages nicht nach
Hause zu begeben, sondern um der Totalität des Ak-
tions-Erlebens und auch der der
Erfahrung der Mauer und ihrer Umgebung willen während der gesamten
Aktions-Tage in der Nähe der Mauer zu über-
nachten. Dazu bedurfte es
kaum Vorbereitungen außer das Bereitstellen von Zelten, wohingegen
die beabsichtigte Gesichtstarnung tatsächlich eine intensivere Vorbereitung
erforderte. Die Grenzposten sollten unter keinen Umständen Fotos von
den Gesichtern der Mauermaler machen können, denn dann war im Falle
der durch diese Fotos ermöglichten Personenidentifizierung ein Verbot
der Nutzung der Transitstrecke, die von Westberlin durch die DDR in die
Bundesrepublik führte zu befürchten. Für Reisen außerhalb
Westberlins wäre dann nur noch das damals vergleichsweise teure Flugzeug
als Trans-
portmittel infrage gekommen. Also
mußte das Gesicht maskiert werden. Die in Apotheken erwerbbaren Gipsbindenrollen
wurden in etwas mehr als die Ge-
sichtsbreite bedeckende Streifen
geschnitten, in Wasser getränkt und an-
schließend auf das Gesicht
gelegt, daß vorher eingecremt wurde, damit der Gips, sobald er getrocknet
war, nicht an der Gesichtshaut haften blieb. Nach-
dem die Maske nach ein paar Minuten
getrocknet war, konnte man sie ab-
nehmen und hatte einen markanten
Gesichtsabdruck der Person. Im Falle der Nutzung während der Strichaktion
wäre dieser Abdruck aber möglicherweise zu markant, denn
eine solche Maskierung mit der eigenen Gesichtsform konnte den DDR-Grenzposten
und der Staatssicherheit eventuell genug Anhaltspunkte liefern, um die
Identität der Person herauszubekommen. Dem konnte man da-
durch begegnen, indem die Maske
noch mit zusätzlich angerührter Gipsmasse überformt
wurde, sodaß am Ende eine teils horroresk, teils clownesk anmuten-
de Maskenform dabei herauskam, dessen
lustiges Erscheinungsbild von Grenz-
posten und MfS später als antisozialistisch
boshaft interpretiert wurde. Zu dem pragmatischen Aspekt der Masken-Herstellung
und Verfremdung gesellte sich der des Spaßes beim freien Formen dieser
bizarren Masken.
Die Aktion
Am Morgen des 3.November fanden sich
die Strich-Akteure bei den Brüdern Onißeit ein, die zusammen
mit Jürgens Frau Anett und deren Sohn am Ma-
riannenplatz 5, zweihundert Meter
schräg gegenüber vom Künstlerhaus Bethanien wohnten, von
wo aus die Strich-Aktion starten sollte.
Die nötigen Utensilien (Farbe,
Pinsel, Getränke, Zelte, Schlafsäcke) wurden auf den Wagen gepackt
und daraufhin liefen alle auf dem Mariannenplatz-Weg
entlang Richtung des für den
Aktions-Beginn gewählten Zielortes. Kaum dort angekommen begann Jürgen
Onißeit im Beisein der anderen Beteiligten eine Erklärung zur
Aktion an die Mauer zu schreiben. Da niemand der vier anderen wußte,
was J.Onißeit genau schreiben würde war mit dem Verfolgen
seiner Tätigkeit eine gewisse Überraschungserwartung verbunden,
deren Resultat sich mit jedem weiteren geschriebenen Wort in der Vorstellung
zu konkre-
tsieren schien, sofern man dem Vorgang
folgte. Als Jürgen O. seinen Text beendet hatte stand da nun über
dem von ihm begonnenen weissen Strich geschrieben:
Dieser Strich wird als Markierung
des Berliner Raums neu vollzogen, um die Mauer rundherum als Ghettowall
bloßzustellen !
Auf den ersten Blick mutet der Satz
in seiner Ausdrucksweise holprig an, aber bei genauerem Hinsehen ist es
eigentlich nur das vor dem Wort "vollzogen" ("gezogen" wäre besser
ausgedrückt) stehende Wort "neu", welches der gan-
zen Erklärung eine umständliche
und sprachlich primitive Erscheinung verleiht, weil man sich fragt, wie
und vor allem warum ein Strich, der sich an dem in der Erklärung gemeinten
Platz (also der Berliner Mauer) bisher noch gar nicht be-
findet, n e u vollzogen werden
soll. Diese Unklarheit läßt sich in zwei Rich-
tungen aufklären, wobei die
folgenden Erläuterungen eine gewisse Toleranz für kleindetailige
Erwägungen voraussetzen.
Wenn die Betonmauer für Jürgen
Onißeit identisch mit der Grenzlinie gewesen ist, dann bedeutet ein
Strich auf dieser Mauer eine Re-Markierung (Neu-
Vollziehung) dieser durch die Mauer
verkörperten Grenzlinie, welche durch Graffitis, Sprüche und
Malereien unkenntlich gemacht (de-markiert) worden ist. Die zweite Interpretation:
Wenn die fünf Meter vor der Westmauer befindliche unsichtbar verlaufende,
aber amtliche Grenzlinie für ihn zwar die offizielle Grenze gewesen
ist, aber er diese nicht als die reale physische für die Westberliner
Einwohner ansah (denn die reale war für ihn die, welche durch die
Berliner Mauer erzwungen wurde), so bedeutet Neu-Vollziehung bzw. Re-Markierung
des Grenzstrichs Veränderung. Veränderung von dessen Position
von der fünf Meter vor der Mauer befindlichen, unsichtbaren Grenze
auf die reale materielle Grenze der Berliner Beton-Mauer. In diesem Falle
würde die spätere Behauptung der Staatsanwaltschaft der DDR ,
die Strich-Maler hätten die Grenze zwischen Ost- und Westberlin zugunsten
Westberlins Erweiterung um fünf Meter an die Mauer verschieben wollen
eine gewisse Berechtigung haben. Das allerdings nur, wenn man unberücksichtigt
läßt, daß es sich bei der Aktion lediglich um die Verdeutlichung
der sowieso bereits bestehenden realen physischen Grenze durch die Mauer
handelte und die 5-Meter DDR-Territorium auf der Mauerwestseite von Westberlinern
ohnehin permanent genutzt wurden, ohne daß sie dafür als Grenzverletzer
vefolgt wurden, welche gar die Grenzen zugunsten Westberlins verschieben
wollen.
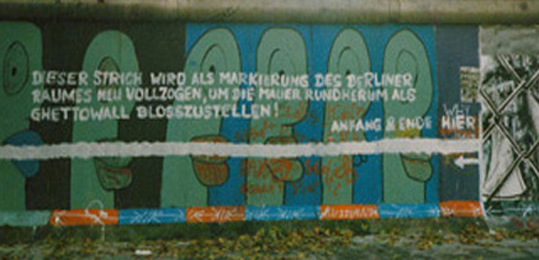
Foto: J.Onisseit
Das von Jürgen Onißeit
mach dem Schreiben der Erklärung gemachte Foto
seines Textes wurde später
in einer von den nach meiner Verhaftung übriggebliebenen vier Mauermalern
gefertigten Dokumentationsbroschüre veröffentlicht, weil
die Erklärung zentrale Bedeutung für die Dokumentierung hatte.
25 Jahre später wurde es in dem von Frank Willmann und seiner Co-
Autorin Anne Hahn produzierten Buch
"Der weisse Strich" nicht veröffentlicht, obwohl es für ein Medienprodukt,
daß en detail auschließlich diese Aktion zum Gegenstand
hat, ein nicht unbedeutendes Dokument ist, daß auch gegen den
Wunsch eines der Beteiligten zumindest
als ein Ereignis innerhalb der Aktion, wenn schon nicht als maßgebliches
veröffentlcht werden sollte. Autor Frank Willmann hat sich nicht nur
an der Ausdrucksweise gestört, die -wie oben gezeigt- beim genaueren
Hinsehen weniger "prollig" ist als wie er zur Begründung seiner Zensur
angegeben hat. Offenbar hat ihn auch der Gehalt der Erklärung selbst
gestört, denn aus ihr geht jene popularisierungsförderliche Motivlage
des weissen Strichs als angebliches Erinnerungszeichen an das Unrecht
auf der Ostseite der Mauer nicht hervor. Eine Motivlage, die bereits 1986
ausschließlich von den Medien kolportiert und 2010 bei der neuerlichen
medialen Thematisierung wiederholt wurde und am eigentlichen, in J.Onißeits
Erklärung unmißverständlich vermittelten Sinn völlig
vorbeigeht. Jener Sinn, für dessen Symbolisierung er versucht hat,
Mitwirkende für diese Aktion zu ge-
winnen.
Strich zu Strich
Nach Beginn des Stricheziehens stellte
sich schnell eine sehr unkomplizierte Vorgehensweise ein. In Abständen
von fünf bis zehn, manchmal auch mehr als zehn Metern versah
man einen jeweils noch strichfreien Mauerbereich mit dem Strich und sobald
man an den Startpunkt des vor einem gemalten Strichab-
schnitts seinen Strich angeschlossen
und somit beide Strichabschnitte ver-
bunden hatte, lief man weit vor
und suchte sich einige Meter vor dem ak-
tuellen "Anführer" des Strichs
einen eigenen Startpunkt, war nun also der neue "Anführer", an dessen
Startpunkt der bisherige seinen Strich schließlich anfü-
gen konnte, während man selbst
bald wieder automatisch in die nachrangige Position versetzt wurde, sobald
einer mit seinem Strichabschnitt fertig war und nach ganz vorn aufrückte,
um einen neuen Anschnitt zu beginnen.
Auf der Strecke vom Mariannenplatz
bis zum Leuschnerdamm gab es keine irgendwie nennenswerten Passanten- Reaktionen.
Mit Jürgen Onißeits Foto-
apparat wurden noch ein paar Fotos
gemacht.
Die Westberliner Polizei informiert
Am Leuschnerdamm kam es dann zu zwei
ersten ernsthaften Außenreaktionen.
Zum einen beklagte sich eine mauermalende
Frau über die Zerstörung ihres
Bildes, zum anderen tauchte die
Westberliner Polizei auf, die darauf hinwies, daß sich in der Mauer
kleine Türchen befinden, durch die die Grenzposten der DDR hindurchschlüpfen
können. Im Falle einer Festnahme sei im Höchstfall mit
zwei Wochen Untersuchungshaft zu rechnen fügten sie auf entsprechende
Anfrage hinzu. Von angeblicher Mäßigungsabsicht der Polizei,
wie es auf Spie-
gel.de zu lesen ist konnte keine
Rede sein. Die Polizei gab uns die Informatio-
nen über die Mauertürchen
und die uns bereits bekannte Tatsache der zur DDR gehörenden 5-Meter-Zone
vor der Westmauer, unterrichtete uns über mögliche Konsequenzen
im Falle einer Festnahme und verabschiedete sich.
Eine Fotografiestudentin taucht
auf
Minuten nach dieser aufschlußreichen
Begegnung mit der Polizei gab es eine weitere Reaktion auf die sich durch
unser Tun bietende Szenerie. Eine Frau, die Fotografie studierte und, um
praktische Erfahrungen beim Fotogra-
fieren zu sammeln, nach diversen
Motiven durch Kreuzberg stöberte, fühlte
sich von unserer Aktion offenbar
zum Fotografieren motiviert. Seit sie mit dem Fotografieren begonnen hatte,
kam Jürgen Onißeits Fotoapparat nicht mehr zum Einsatz. Ich
erinnere keinerlei mit der Fotografin besprochene Vereinba-
rungen über Foto-Nutzungen,
da ich mich nur für ein "Hallo" vom Malen hatte unterbrechen lassen.
Alsa naheliegnd kann ich mir jedoch vorstellen, daß wir der Fotografin
erklärten, daß sie uns im Falle von Veröffentlichungsabsichten
vorher fragen solle. Daß wir aber die Fotografin fragten, ob wir
die Bilder, egal
in welchem Rahmen und in welcher
Größenordnung ohne jede Anfrage und Honorierung jederzeit verwenden
könnten scheint mir angesichts unserer
geringen Veröffentlichungsabsichten
eher unwahrscheinlich.
Es handelte sich bei unserer Aktion
ja nicht um eine auf Medialität setzende oder darauf spekulierende
Kunstaktion, bei der Honorarvereinbarungen und Verwertungsrechte irgendeine
Rolle spielten.
25 Jahre später hat sich unter
dem starken Tobak der aufgeblasenen Histo-
risierung der Strich-Aktion
die Situation geändert. Nicht nur fiel Jürgen Oni-
ßeits Mauerstricherklärung
wie oben erwähnt unter den Tisch, auch sprach man nun nur noch von
Kunstaktion, in Kunst gekleidetem Protest, mitunter sogar von bahnbrechendem
Kunstwerk, gar Monument. In dieser nachträglich aufgeblasenene Bedeutungsgewichtigkeit
hatte es nun angeblich eine Ab-
sprache über die uneingeschränkte
öffentliche Nutzung der Fotos durch die Künstler gegeben. Als
hätte damals vor meiner Inhaftierung die große Öffentlichkeit
überhaupt eine Rolle in den Erwägungen gespielt.
Kontakt mit der Tageszeitung
"BZ"
Wie sehr diese mediale Kultivierung
dem damaligen "Geist" der Aktion wider-
sprach, zeigt bereits die nächste
Reaktion auf die Tätigkeit der fünf Maler. Sie bestand in dem
Versuch zweier Journalisten von der Berliner Tageszeitung "BZ" ("Berliner
Zeitung"), mit den Strichmalern ein Interview zu führen. Mit Aus-
nahme von Thomas Onißeit,
dessen insbesondere künstlerisches Mitteilungs-
bedürfnis seinerzeit erheblich
war, sobald man ihm die von ihm erwünschte Aufmerksamkeit zuteil
werden ließ, lehnten die Strichmaler es ab, den Journa-
listen Rede und Antwort zu stehen,
weil der Kontakt zu Medien gar nicht beabsichtigt gewesen ist, da grundsätzlich
kein Interesse daran bestand. Hinzu kam bei der mehrheitlichen Verweigerung
gegenüber den Herren von der "BZ" noch, daß sie von dem Verlag
kamen, der Minuten zuvor auf unsere höfliche Anfrage hin untersagt
hatte, ihr Gelände zu betreten, welches direkt an die Berliner Mauer
angrenzte und daher zur Fortsetzung des Strichs zu begehen nötig wurde.
So wenig kooperativ sie sich in dieser Hinsicht zeigten, so sehr waren
sie es, wenn es um die Verfolgung ihrer eigenen Ziele ging. Immerhin ist
das Auftauchen der BZ-Journalisten ein Zeitzeugnis für den unspektakulären
Charakter der Aktion, denn obwohl das Interview mit. T.Onißeit mittags
und also noch vor Redaktionsschluß geführt wurde fand man am
4.11.86 in dieser Zeitung keine Notiz über die Aktion. Die Thematisierung
in diesem Blatt erfolgte erst am 5.11., dem Tag nach meiner Festnahme.
Statt die Mauer auf dem Betriebsgelände des Axel-Springer-Verlages
zu bemalen wurde nach der Zutrittsverweigerung des Verlages der Strich
auf dem Boden um das Springergelände herum gezogen, denn die reale
physishe Grenze für den Westberliner Bewohner war hier also die durch
das Verlagsgelände Springers festgelegte, was wiederum deutlich macht,
wie erstrangig die Markierung der dem Westberliner Einwohner gesetzten
physischen Grenze war, egal durch welches Objekt diese Grenze jeweils
real wurde.
Für diese Strichziehung am Boden
sollte eine saftige Geldstrafe fällig werden, wurde aufgrund der späteren
dramatischen Ereignise der DDR-Inhaftierung aber fallengelassen und gewissermaßen
in Form eines erstklassigen Schlag-
zeilen-Aufmachers abbezahlt, über
den in diesem Text weiter unten noch berichtet wird.
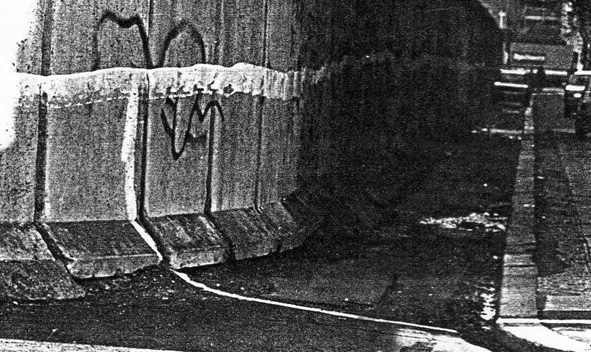
Vor Beginn des Springergeländes
zweigten wir den Strich von der Mauer zum Boden hin ab, weil die Verlagsbonzen
uns nicht auf ihr Gelände ließen, an dessen einer Außenseite
sich
die Berliner Mauer befand und wir
keine Möglichkeiten hatten, außerhalb des Springer-
geländes an dieses Stück
Mauer zu gelangen. Der Strich wurde deshalb auf dem Geh-
weg komplett um das Gelände
gezogen. (Foto:Grepo-Wachturm-Foto, MfS-Unterlagen)
Checkpoint Charly
Westberliner Polizei, wütende
Malerin, Fotografin, BZ-Jornalisten, die wenigen Reaktionen, die es bisher
gegeben hatte waren allesamt "nicht ohne" gewesen. Noch weniger war es
eine weitere Reaktion, welche beim Überqueren des Grenzübergangs
Checkpoint Charly erfolgte. Beim Übermalen des offiziellen weissen
Grenzstrichs, der sich am Checkpoint Charly direkt auf dem Boden der Straße
befand versuchten DDR-Grenzposten, Frank Schuster in den Osten zu ziehen,
was ihnen jedoch mißlang. Das Problem war dadurch entstanden,
daß der auf dem Boden befindliche
Grenzstrich in kompletter Breite zum DDR-
Territorium gehörte und ein
Übermalen nicht nur als ein Eindringen auf das Hohheitsgebiet der
DDR angesehen werden konnte, sondern damit auch alle Rechte zu einer Festnahme
bot. Nachdem zu den Informationen der Westber-
liner Polizei nun dieser Zwischenfall
hinzugekommen war gab es fortan keinen Zweifel darüber, daß
im ungünstigen Fall ein Transitverbot nicht die drastischste Konsequenz
der Aktion sein könnte.

Raucherpause. Nach erfolgreicher
Nachzeichnung des offiziellen Grenzstrichs auf dem Strassenboden der Grenzübergangsstelle
Checkpoint Charly gönnen sich T.Onißeit (siehe
den kuriosen Pfeil des Straßenschildes
in der Bildmitte) und ich eine Zigarette.Während des Strichziehens
wurde nicht geraucht, da die Hände für das Halten von Eimer und
Pinsel benö-
tigt wurden. (Foto: Grepo-Protokolle)
Dieser Zwischenfall hatte sich am
Nachmittag ereignet. Wir setzten nach einer zunächst nur kurzen Pause
unsere Tätigkeit nach Passieren des Checkpoint Charly nun wieder direkt
auf der Mauerfläche fort und machten dann auf Höhe Stresemannstraße
hinter einem -Sichtschutz vor Grepos gewährenden- Bau-
wagen eine grössere Pause,
während der die Fotografin einige Fotos schoß. Niemand hatte
zu diesem Zeitpunkt die Maske auf. Keiner zog in Erwägung, daß
die Fotografin durchaus hätte vom MfS geschickt sein können.
Dem ost-
deutschen Geheimdienst wäre
es ein leichtes gewesen, einen seiner Mitarbei-
ter auf uns Strichmaler anzusetzen,
um deren Identität herauszubekommen oder gar, sie auf irgendeine Weise
an der Fortführung ihrer Tätigkeit zu hin-
dern. Nach Ende der Pause setzten
wir in Begleitung der einsetzenden Däm-
merung unsere Arbeit Richtung
Potsdamer Platz fort, den wir erreichten, als es dunkel geworden war. Wir
bauten die Zelte auf, tranken und redeten. Später verabschiedete sich
Frank Schuster, da er wegen eines Termins am frühen Morgen die Nacht
nicht im Zelt verbringen konnte.
4.11.1986
Am nächsten Morgen verabschiedete
sich auch noch Thomas Onißeit wegen einer Führerscheinstunde
vorübergehend von der Gruppe, sodaß die Strich-
Arbeit zunächst zu dritt fortgeführt
werden mußte. Wir hatten im Tiergarten gezeltet und mußten
zurück zum Potsdamer Platz, wo wir am Vortag mit dem weißen
Strich aufgehört hatten. Dort begann auch der eine Zaunflügel
des
Lenné-Dreiecks,
einem verwilderten auf Westseite der Mauer noch zu Ostberlin gehörenden,
gewissermaßen aus der Westmauer herausragenden Bereich von schätzungsweise
mindestens 150x 150x 150 Metern. Während Jürgen Onißeit
den Utensilien-Wagen durch den Tiergarten und fernab der Mauer Richtung
Brandenburger Tor schob, setzten am Morgen des 4. 11. 1986 nur Frank Willmann
und ich das Strichziehen fort.
Als wir auf der Tiergartenseite des
Lenné-Dreiecks
dessen Zaun anmalten kam uns ein männlicher Berliner Bürger
entgegen, der verständlicherweise offenbar nicht nachvollziehen konnte,
daß Menschen den Metallzaun eines vernachläs-
sigten Ostberliner Wildwuchs-Biotops
mit einem weißen Strich anmalen. Mit den Worten "Ihr solltet lieber
einer alten Frau das Badezimmer streichen."
ließ er uns seine Meinung
über unser Tun wissen. Vielleicht war es angesichts dessen,
was sich Minuten später ereignete, mehr noch als ein Kommentar vor
allem eine unbeabsichtigte Warnung.
 sw.jpg)
(Foto © Stefan Micheel )
Mauer am Potsdamer Platz:
links ab Mauersegmentende der Anfang des Metallzaun des an
die Mauer angrenzenden Lenne-Dreiecks, welches auf der Westseite der Mauer
zum Territorium Ostberlins gehörte. (Foto-Copyrigt Stefan Micheel
)
Weiter mit Festnahme |

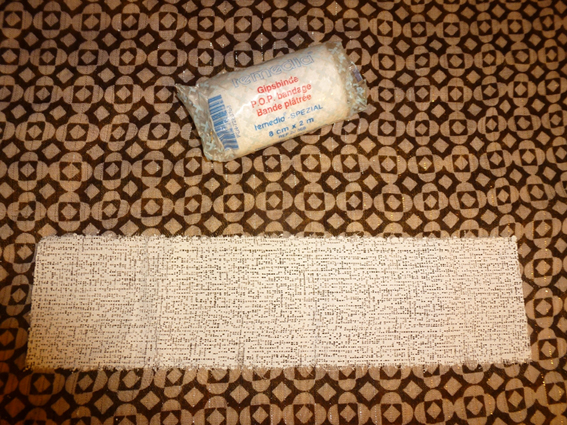

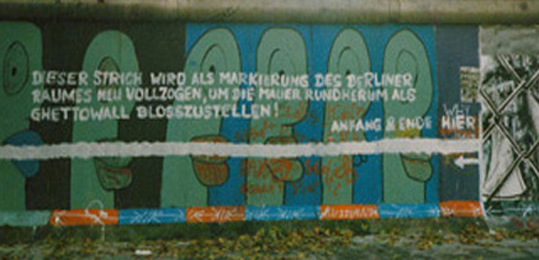
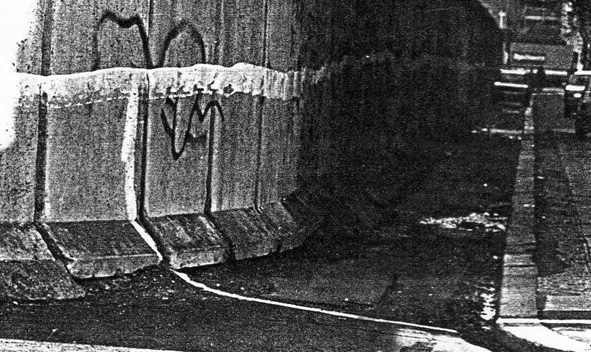

 sw.jpg)